Funkeninduktor und Fritter (Kohärer)
Inhaltsverzeichnis
-
1. Einleitung
2. Der Hammer-Oszillator
3. Der Funkeninduktor
4. Prickelnde wundersame Arznei...
5. Das Störsender-Experiment. Verboten, aber amusant!
6. Der Funken-Empfänger
7. Der Fritter-Empfänger
8. Zwei Fotos aus alten Zeiten
-
8.1 Ein 100 Jahre altes Buch über Elektrotechnik
-
9.1 Der Funkeninduktor und der selbstgebaute Kondensator
1. Einleitung
Lange Zeit vor der Erfindung der Radioröhre wurde das Senden und
Empfangen elektromagnetischer Wellen erfunden und militärisch und zivil
genutzt. Ich habe es bisher zwar nirgends gelesen, aber ich gehe davon
aus, dass es Naturbeobachtung war, welche die allerersten Anregungen zum
Nachdenken über drahtlose Telegraphie weckten. Zu allen Zeiten bis heute
staunt der Mensch über die Feuerwerke am Himmel, wenn sich Wolken
verdichten und kräftige Blitze zucken und vereinzelt auch einschlagen.
Geschieht dies, kann man aus sicherer jedoch nicht allzu grosser Distanz
immer wieder beobachten, wie es zwischen isoliert aufgespannten Drähten
und metallenen zur Erde leitenden Objekten zu kleinen Funkenüberschlagen
kommt. Beobachtbar ist solches allerdings nur wenn es ausreichend dunkel
ist.
Im vorletzten Jahrhundert gelang es diesen Vorgang künstlich
duchzuführen, und damit war der Weg zur Entwicklung des
elektromagnetischen drahtlosen Funks, zunächst ohne verstärkenden
Bauteile (Radioröhren), eröffnet. Diese Versuche kann im kleinen
Massstab jeder selbst durchführen und davon berichtet dieser
Elektronik-Minikurs. Diese Spielerei habe ich zu meiner Schulzeit in den
1950er-Jahre selbst durchgeführt.
Um die vorletzte Jahrhundertwende war diese Spielerei eine ernste
Angelegenheit. Es war die Epoche der ersten drahtlosen Telegraphie mit
gedämpften Wellen durch den Einsatz von starken Funkensendern und
mechanisch aufgebauten und subtil abgestimmten Fritter-Empfängern,
auch Kohärer-Empfänger genannt. Im ersten Weltkrieg waren solche
Sendeanlagen intensiv im Einsatz. Im ersten Drittel des letzten
Jahrhunderts bahnte sich allerdings bald das Ende an, als Lieben seine
verstärkende Radioröhre, die Triode, erfand und die elektronische Sende-
und Empfangstechnik mit der Übertragung von ungedämpften Schwingungen
ihren Siegeszug antrat.
Bevor ich damit beginne aus dem eigenen "Nähkästchen" über längst
vergangene Tage zu plaudern, will ich auf einen sehr interessanten Link
bezüglich Geschichte der Funktechnik aufmerksam machen. Es geht um die
drahtlose Telegraphie mit gedämpften elektromagnetischen Schwingungen
in der Vorelektronikära. 1897 war das Geburtsjahr der drahtlosen
Telegraphie mit elektromagnetischen Wellen. Nach Patentanmeldung und
postinternen Vorführungen in England stellte der Italiener Marconi seine
mit elektrischen Funken über 14 km arbeitende Anlage im Mai am
Bristolkanal der Öffentlichkeit vor. Die spannende Fortsetzung davon
liest man in der Webseite von Hans-Joachim Ellissen in insgesamt vier
Teilen:
2. Der Hammer-Oszillator

Fast jeder weiss wie eine elektrische Klingel funktioniert. Beim Anlegen einer Gleichspannung zieht die magnetisierte Spule eine bewegliche Weicheisenplatte an. An dieser ist ein kleiner Hebel befestigt. An dessen Ende sitzt eine kleine Metallkugel welche auf eine Glockenschale schlägt. An der beweglichen kleinen Eisenplatte ist eine Kontaktfeder montiert. Im stromlosen und nichtmagnetisierten Zustand der Spule S schliesst diese Kontaktfeder als Ruhekontakt K mit einem festmontierten Kontaktbolzen den Stromkreis zwischen Spannungsquelle B (hier eine Batterie) und Spule S. Es fliesst ein Strom I durch S und die die Metallplatte wird durch den Eisenkern der Spule angezogen. Damit öffnet K den Stromkreis und die Kugel schlägt kurz auf die Glockenschale. Stromfluss und Magnetisierung fallen weg und K schliesst erneut den Stromkreis. Die elektromechanische Oszillation setzt sich fort. In Bild 1 wird dies in der Bildfolge von 1 bis 4 dargestellt und Maki, das Lemurenäffchen aus Madagaskar, erinnert uns, dass dieses Prinzip in den alten Telefonapparaten im Einsatz war. Dieses uralte elektromechanische Oszillationsprinzip nennt man den Wagner'schen Hammer. Er funktioniert auch mit Wechselstrom, wobei die Klingelfrequenz auf einer Mischfrequenz aus Netzfrequenz und Glockenresonanzfrequenz ungleichmässig arbeitet.
3. Der Funkeninduktor
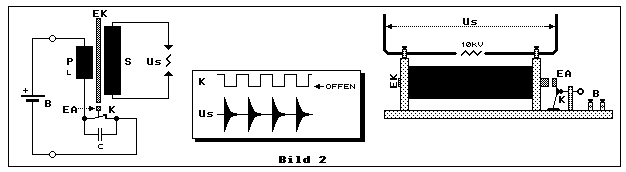
Wer unter den älteren Lesern weiss noch was ein Funkeninduktor ist? Nun,
für die welche es nicht (mehr) wissen, er ist eine Art
Weiterentwicklung der obengenannten elektrischen Klingel. Der
Funkeninduktor hat keine Klingelmechanik, dafür einen viel grösseren
Spulenkörper. Da drauf hat es, sehr gut isoliert, eine zweite
Sekundärspule S aus sehr dünnem Draht mit einer sehr hohen
Windungszahl. Es ist ein Transformator mit der selben Funktion wie die
der Autozündspule. Die Selbstinduktionsspannung an der Primärspule,
welche durch das Öffnen des Ruhekontaktes K entsteht, multipliziert
sich mit dem Windungszahlverhältnis der Sekundär- zur Primärspule.
Dadurch entsteht eine Sekundärspannung von vielen tausend Volt. 10'000
Volt liegen durchaus drin. Eine zuoberst auf dem Funkeninduktor
montierte, in der Länge einstellbare Funkenstrecke, demonstriert die
hohen Spannungswerte durch Funkenüberschläge. Es ist jedoch keine
konstante Wechselspannung. Es sind einzelne Schwingungspackete in Form
von gedämpften Schwingungen, wie es im Kasten von Bild 2 gezeigt wird:
Bei jedem Öffnen des Kontaktes K entsteht über der Primärwicklung P eine
Selbstinduktionsspannung in Form einer gedämpften Schwingung. Die selben
gedämpften Schwingungspackete treten mit hoher Spannung an den
Anschlüssen der Sekundärspule S auf.
Es gibt aber einen grundsätzlichen Unterschied zwischen der Arbeitsweise
eines Funkeninduktors und einer Autozündspule. Die des Funkeninduktors
ist selbsterregend oder selbstschwingend: Die stromdurchflossene
Primärwicklung P erzeugt in einem offenen Eisenkern ein Magnetfeld, das
die Feder des Kontaktes K anzieht. Dadurch unterbricht K den Stromkreis
und das Magnetfeld baut sich schnell ab. Dies erzeugt die gedämpfte
Hochspannungsschwingung und die Kontaktfeder fällt zurück und schliesst
erneut den Stromkreis. Eine Autozündspule wird durch einen externen
Unterbrecher, der mit der Kolbentätigkeit synchronisiert ist, angeregt.
Es leuchtet ja auch ein, dass ein Zündfunken erst dann entstehen darf,
wenn das Gas/Sauerstoff-Gemisch im Kolbenraum komprimiert ist und der
Kolben in Richtung Dekompression bereitsteht.
Kondensator C dient beim Funkeninduktor und bei der Autozündspule dem
raschen Löschen des Funkens beim Öffnen des Kontaktes K, damit der Strom
im Primärkreis P möglichst schnell unterbricht und sich die hohe
Selbstinduktionsspannung aufbauen kann. C verhindert zusätzlich den
sonst zu schnellen Kontaktabbrand.
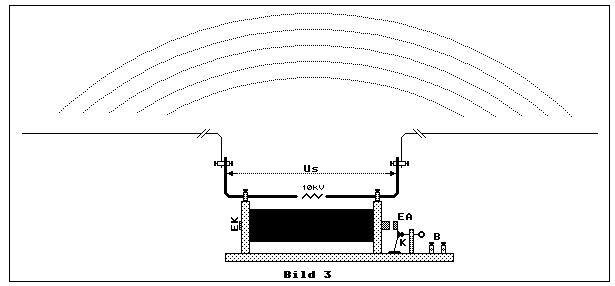
An den Elektrodenanschlüssen entsteht bei jedem Funken ein sehr steilflankiger Spannungseinbruch. Vergrössert man diese Elektroden durch zwei lange Leitungen, von z.B. je einem Meter oder auch mehr zu einem offenen Antennendipol, hat man einen perfekten "dreckigen" Störsender, der das Langwellen-, Mittelwellen-, Kurzwellen- und UKW-Band massiv stört. Genau so, wie dies die Zündfunkenanlage eines Automobils ebenso tut, wenn nicht entsprechende Entstörmassnahmen getroffen werden. In den 1950er-Jahren, als die ersten UKW-Empfänger aufkamen, konnte man das noch nicht entstörte Auto gut 100 bis 200 Meter entfernt mit einem UKW-Empfänger wahrnehmen, weil die viel zu schlechte und zu wenig induktionsarme Abschirmung der Karrosserie dämpft die Störstrahlung nur sehr ungenügend im UKW-Bereich. Die wirksame Entstörung liegt in den Seriewiderständen an den Ausgängen von Zündspule und Verteiler. Diese Widerstände bilden mit dem Kabel und dessen Umgebung als Kapazität ein Tiefpassfilter. Dies erzeugt eine geringere Flankensteilheit und damit reduziert sich die Bandbreite der Störfrequenz.
4. Prickelnde wundersame Arznei...
Während meiner Schulzeit in den 1950er-Jahren, schenkte mir jemand einen
Funkeninduktor, der mich sogleich faszinierte. Ich experimentierte oft.
Von irgendwo her, hatte ich ganz spezielle und komisch aussehende
Geisslerröhren mit nur einer Metallelektrode. Sie stammten von einem
Eletrisierapparaten, der nach dem selben Funkeninduktorprinzip
arbeitete. Diese Metallelektrode verbindet man mit der hohen
Wechselspannung mit vielen tausend Volt und mit dem andern Ende des
Glaskolben "streichelte" man die Haut. Dieses Prickeln soll für eine
gute Durchblutung gesorgt haben und mit so einem Argument machten die
Doktoren früher mal gutes Geld. Als Nebeneffekt duftete es herrlich
nach Ozon. Im abgedunkelten Raum konnte man das schöne dünne
blauviolette Leuchten im Innern des Glaskoblens beobachten, das einem
sogleich an die Nord- oder Südlicht-Auren erinnert, die schliesslich
ähnlich zustande kommen. Führt man dieses Experiment mit einem
Funkeninduktor gemäss Bild 2 aus, muss man den einen
Hochspannungsanschluss erden und der andere Anschluss ist dann mit Bezug
auf die Erde die asymmetrische Hochspannungsquelle.
Geisslerröhren sind nichts anderes als Glasröhren mit sehr stark
verdünnter Luft oder einem Gas oder Gasgemisch, welches unter Einfluss
von hoher Wechselspannung Strom durch das Fastvakuum leitet, weil sich
die Gasatome ionisieren. Erfunden hat dies ein Mechaniker namens
Heinrich Geissler, der in der frühen Pionierzeit der Elektrotechnik und
Physik zwischen 1815 und 1879 lebte. Füllt man Geisslerröhren mit
unterschiedlichen Gasen, kann man auf einfache Weise Spektralanaysen
dieser Gasgemische durchführen.
5. Das Störsender-Experiment. Verboten, aber amusant!
Das folgende Experiment, setzt ebenfalls voraus, dass der eine Hochspannungsanschluss geerdet ist. Der andere Anschluss wird mit einer Antenne verbunden:
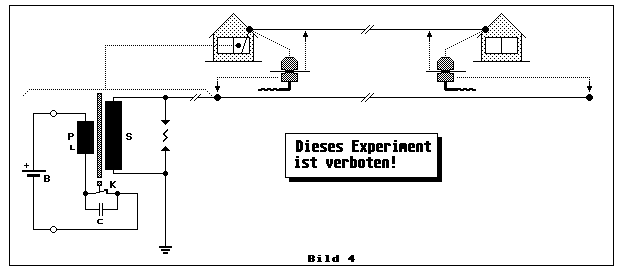
Die ersten Störsenderversuche mit kurzem Antennendraht, aufgespannt in
einem Zimmer von wenigen Metern, hatte ich bereits hinter mit. Es war
damit möglich zu lautes Radiohören in der Nachbarschaft wirksam zu
verhindern. So hatte es in der Nachbarschaft einen Tessiner oder
Italiener der um die Mittagszeit oft den italienisch-schweizerischen
Landessender Monte Ceneri auf der Mittelwelle auf 558 kHz hörte und die
Opern lauthals mitgesungen hatte. Ich hatte immer wiedermal die Nase
voll davon und schaltete stolz meinen breitbandigen Störsender kurz ein.
Dieser prasselte aus dem Radio des Nachbarn mindestens drei Mal so laut,
weil Monte Ceneri (damals mit einer Sendeleistung von 50 kW und heute
300 kW) in Basel keine allzu grosse Feldstärke mehr erzeugte. Der Mann
fluchte laut wie ein Rohrspatz und er stellte das Radio ab. Bei einem
erneuten Hörversuch, wiederholte ich das Spiel. Er ist zu meinem grossen
Glück nie dahinter gekommen, was oder wer die fast synchron
einschaltende Störquelle sein könnte. :-)
Irgendwann gegen Ende der 1950er-Jahre war es so weit, als das erste
Kofferradio der Marke Accord im schönen Holzgehäuse die Wohnung meiner
Eltern schmückte und rasch meine Aufmerksamkeit weckte. Endlich hatte
ich ein transportables Radio um meine Funkversuche mit Unterstützung
des Velos (Fahrad) auszudehnen. Dazu vergrösserte ich erstmal die
Sendeantenne, wie dies Bild 4 etwa illustriert. Das Bild zeigt ein
aufgespannter Draht von etwa zehn Meter Länge, montiert an zwei
Weidezaunisolatoren an den Aussenwänden von zwei Dachmansarden. Einen
dritten Isolator montierte ich weiter oben ausserhalb eines kleinen
Dachfensters. Von da aus gingen zusätzlich zwei Antennendrähte zu den
beiden Isolatoren der Mansarden. Wie ich damals zu diesen
Weidezaunisolatoren gekommen bin, ist nicht Gegenstand dieses
Elektronik-Minikurses... :-)
Das Antennensystem sah also fast so aus wie ein gleichschenkliges
Dreieck mit einer Gesamtlänge von mindestens 30 Metern. Daran hängte
ich den Hochspannungsausgang des Funkeninduktors. Die Kapazität dieser
Antenne führte dazu, dass die Funkenstrecke wegen dem Spannungsabfall
etwas kleiner eingestellt werden musste, dafür aber die Funken zwischen
den beiden Elektrodenspitzen herrlich laut prasselten, weil durch diese
Kapazität die Entladungsströme grösser werden. Nun packte ich das
Kofferradio und befestigte es gut auf dem Gepäckträger des Velo und
ich fuhr weg. In Abständen von etwa 100 Metern hielt ich jeweils an und
testete den Empfang auf Lang-, Mittel- und Kurzwelle. Mit zunehmender
Entfernung vom Sender machte sich eine schwache Selektivität im
höheren Frequenzbereich der Mittelwelle, so etwa bei 1200 kHz, hörbar.
Auf dieser Frequenz konnte ich mein selbstproduziertes "Gewitter", mehr
als 1 km Entfernung vom Sender, gerade noch schwach aus dem Lautsprecher
hören.
An dieser Stelle ist es meine (juristische) Pflicht anzumerken, dass
solche Experimente grundsätzlich jedem heutigen Fernmeldegesetz
widersprechen und nicht durchgeführt werden dürfen! Da man solche
archaischen Radioexperimente allerdings auch irgendwo auf einer Alp,
z.B. im Himalaya, oder auf einer fernen Insel mit Batterien ohne
Stromanschluss, weit weg von der Zivilisation die in der Lage wäre den
Störsender zu empfangen, durchführen kann, darf man dieses Experiment
in einem Elektronik-Minikurs durchaus erwähnen und letztlich ist jeder
selbst dafür verantwortlich, wie er oder sie mit seinen erworbenen
Erkenntnissen umgeht. Damit wäre dies ein für allemal klar und
deutlich erwähnt. :-)
Die ersten Gesetze betreffs Verbot von breitbandigen Funkensendern gehen
bereits auf das Jahr 1927 zurück. Neue Sender dieser Art, man nannte sie
B-Wellen-Sender, durften im zu Ende gehenden deutschen Kaiserreich ab
Januar 1929 bei Land- und festen Funkstellen nicht mehr errichtet werden
(Landfunkstellen: Küstenfunkstellen, Boden-Flugfunkstellen). Funkstellen
der festen Dienste wie z.B. Überseefunk, Inland- und Europafunk (jedoch
ohne Rundfunk), Sonderdienste (Funkfeuer, Peilstellen, Zeitzeichen o.ä.).
Der aufmerksame Leser stellt sich an dieser Stelle natürlich die Frage,
wie es denn möglich ist weit mehr als 100 km zu überbrücken, wenn es
mir gerade mal für 1 km reichte. Ganz einfach: Zur Erzeugung von
gedämpften Schwingungen mit ähnlich hohen oder noch höheren Spannungen
benutzte man ebenfalls das Prinzip des Funkeninduktors. Allerdings baute
man solche, die in der Lage waren neben der hohen Spannung auch hohe
Ströme zu liefern, damit die Spannung nicht zusammenbrach, wenn die
Länge der Antenne an den ungefähren Wellenlängebereich angepasst wurde.
Man arbeitete vorwiegend auf Lang- und Längstwelle, also im Bereich um
die 100 kHz. Bei einer Viertelwellenlänge, der optimalen
Antennendrahtlänge, beträgt diese bei einer Sendefrequenz von 100 kHz
immerhin stolze 750 Meter, montiert auf mehreren hohen Masten. Mehr zu
diesem Thema liest man im oben genannten
Link
in der Einleitung.
6. Der Funken-Empfänger
Diese ersten Funkensender konnten weder amplituden- und schon gar nicht
frequenzmoduliert werden. Also war an eine Übertragung von Sprache und
Musik noch gar nicht zu denken. Zur Anwendung kam das Morsen, das nur
den binären Zustand Strom ein und Strom aus kennt. Entweder es wird ein
Strich, ein Punkt oder nichts auf einen Papierstreifen gezeichnet.
Wie dies damals vor und um die vorletzte Jahrhundertwende drahtlos
möglich war, wollen wir hier etwas näher betrachten.
Die Sache mit dem Sender ist schnell geklärt. Eine Morsetaste schaltete
den Funkensender ein und aus. Die Dauer des Tastendrucks bestimmt, wie
bei der drahtgebundenen Übertragung, ob ein Strich oder ein Punkt
gesendet wird. Was den Empfänger betrifft, wollen wir uns aber
schrittweise an das Funktionsprinzip herantasten. Wir befassen uns im
nächsten Kapitel mit dem sogenannten Fritter, auch Kohärer genannt.
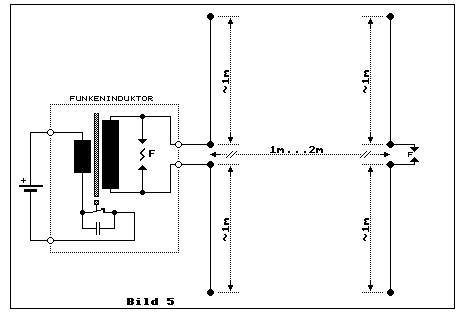
Bild 5 zeigt uns links den Funkensender mit einem Funkeninduktor im Versuchsaufbau. Keiner der Hochspannungsanschlüsse ist hier geerdet. Es ist eine offene Dipolantenne mit etwa 2 Meter Spannweite im Einsatz. Dieser einfache Versuchsaufbau ist in einem beliebigen Wohnzimmer durchführbar. Im Abstand von etwa 1 bis 2 Meter baut man den Empfänger mit der selben Dipolantenne mit einer sehr kleinen Funkenstrecke (F) von etwa einem Millimeter auf. Dass alle Antennenmontagepunkte gut isoliert sein müssen, versteht sich von selbst. Man schaltet den Funkeninduktor ein und der grosse Funke F funkt kräftig. Nun dunkelt man das Zimmer so gut ab wie möglich. Am besten eignet dieses Experiment nachts, wenn es ganz dunkel ist. Nun beobachtet man die kleine Funkenstrecke F bei der Empfangsantenne und man bemerkt schwache Funken. Genau dies waren die allerersten Versuche im vorletzten Jahrhundert mit Funkensendern und Funkenempfängern. Für den Empfänger eignet sich ebenso eine Dipolantenne mit geschlossenem Kreis, sowie man heute Dipolantennen für den UKW-Empfang benutzt. Dort wo der symmetrische Antennenanschluss ist, muss eine kleine Funkenstrecke platziert werden.
7. Der Fritter-Empfänger
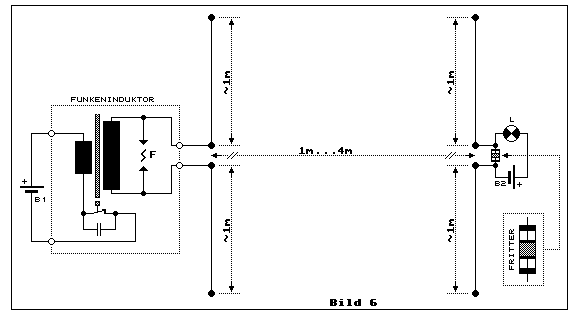
Man betrachte in Bild 6 auf der rechten Seite die Empfängerschaltung.
Der Fritter, auch Kohärer genannt, besteht aus einem kleinen Glasrohr-
oder Plexiglaszylinder mit einem Durchmesser von etwa 1 cm und einer
Länge von etwa 5 bis 10 cm. Beide Enden sind mit je einem Gummistöpsel
verschlossen und durch deren Mitte geht von aussen nach innen eine
aussen elektrisch kontaktierbare Metallnadel. Die Nadelenden im innern
des Glasrohrs sind mit einem metallenen Zylinder mechanisch verbunden.
Zwischen diesen beiden Zylindern als Funktion von Elektroden hat es
feines Metallpulver, vorzugsweise aus Nickel.
Das Metallpulver liegt so locker zwischen den Elektroden, dass ein
elektrischer Kontakt zwischen den beiden Elektroden im Glasrohr gerade
noch nicht möglich ist. An den Nadelenden ausserhalb des Rohres
verbindet man zwei freiliegende, besser aufgehängte, Drähte von je
einem Meter Länge oder mehr. Dies ist die Dipolantenne für den
Empfang. Zusätzlich schliesst man diesen Fritter in einen
Stromkreislauf, der z.B. ein Relais oder eine kleine Lampe steuert.
Damit ist der Fritter-Empfänger vorbereitet. Warum Fritten das
Zusammenbacken pulverförmiger Bestandteile bedeutet, werden wir gleich
erkennen.
Man schaltet jetzt den Funkeninduktor ein, dessen Anordnung vom
Fritter-Empfänger einige Meter entfernt aufgebaut wird. Nun stellt man
mit Erstaunen fest, dass das Relais anzieht oder die kleine Lampe
leuchtet. Allerdings bleibt der Zustand erhalten wenn der Funkensender
wieder ausgeschaltet wird. Die Metallpulverteile haben sich durch den
Einfluss des E-Feldes zwischen den Elektroden ausgerichtet und bilden
viele Kontaktbrücken. Es genügt bei ausgeschaltetem Funkensender
allerdings ein feines Klopfen an das Glasrohr und die Metallpulverteile
verteilen sich erneut chaotisch und der Fritter verliert seine
Kontaktwirkung.
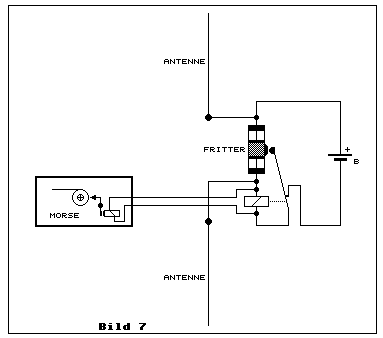
Man erfand damals die Methode dies mittels Wagner'schen Hammer zu
automatisieren: Jedesmal wenn durch Empfang der Fritter Strom leitet,
wird eine Spule magnetisiert die eine bewegliches Eisenplättchen
anzieht, die einer Klingel ähnlich, mit einer kleinem kleinen Bolzen
auf das Glasrohr schlägt und so den Fritterkontakt wieder unterbricht.
Wenn der Funkensender eine Impulsfolgefrequenz liefert die niedriger ist
als die Eigenresonanzfrequenz der elektromechanischen
Fritter-Empfängerschaltung, ist es möglich Impulsketten zu übertragen,
entweder für Steuerzwecke oder für Nachrichten (Morsezeichen).
Wichtig für den erfolgreichen Einsatz von Morseschreibern waren
schnelle Fritterempfänger. Dies setzt voraus, dass der Kontaktweg und
der Weg vom Bolzen zum Glaskolben sehr kurz ist. Damit erreicht man eine
möglichst hohe Resonanzfrequenz des elektromechanischen Systems.
Die Spule des Morseschreibgerätes wurde parallel mit der Spule des
Fritters geschaltet. Dieses elktromechanische System - im Prinzip ein
Relais - musste etwas träger arbeiten als der Fritter selbst, damit der
Anker des Morse-Relais so lange angezogen bleibt, wie der Fritter eine
konstante Funkwelle empfängt und der Fritter oszilliert. Nur während
der Funkpause, also zwischen Strichen und Punkten des Morseaphabetes,
darf der Anker des Morserelais abfallen. Im angezogenen Zustand des
Ankers drückt der montierte Schreibstift auf die drehende Papierrolle.
Die Vorschubgeschwindigkeit des Papieres und die Arbeitsfrequenz an der
Morsetaste bestimmte die Länge der Striche und Punkte auf dem
Papierstreifen.
8. Zwei Fotos aus alten Zeiten
Die folgenden beiden Fotos eines Funkempfängers aus dem Jahre 1902 vermitteln einen Eindruck wie diese Geräte damals ausgesehen haben. Die Wiedergabe dieser beiden Bilder, mit dem dazugehörigen Text, erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Betreibers der Webseite. Hier noch einmal seine sehr empfehlenswerte Webseite über die drahtlose Telegraphie mit gedämpften elektromagnetischen Schwingungen, beginnend mit den Pionieren Faraday, Maxwell, Örstedt, Hertz, Branly, Popow und Marconi und mit den Lichtbogensendern und mit den ersten Sendern in Röhrentechnik mit ungedämpften Schwingungen schliessend, - eine wahre Fundgrube für Interessierte an der Geschichte der Elektrotechnik und Elektronik:
Der Kohärer - auch Fritter genannt - wurde 1890 von Eduard Branly
erfunden. Er besteht aus einem Glasröhrchen mit zwei Elektroden zwischen
denen sich feines Metallpulver befindet. Zwischen den Elektroden liegt
normalerweise ein sehr hoher Widerstand. Treten in der Nähe dieser
Anordnung elektromagnetische Wellen auf, wird das System leitend, weil
sich das Metallpulver miteinander verbindet. Da die Metallspäne auch
nach Beendigung der elektromagnetischen Wellen verbunden bleiben, wird
der nichtleitende Zustand durch Beklopfen des Glasröhrchens nach jedem
Zeichen wiederhergestellt.
Funkempfänger mit Schreiber von 1902 (System Braun):
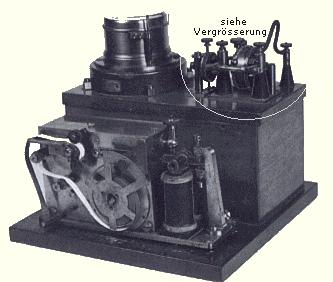
Der Kohärer ist direkt in den aus Reihe geschalteten Spulenelementen
gebildeten "Abstimmkreis" zwischen Antenne und Erde gelegt. Ein in den
Kohärerkreis geschaltetes Relais bedient Klopfer und Morseschreiber.
Hörempfang ist mit diesem Gerät nicht möglich. Nach Berichten war der
Kohärer mit seinen "Locker-Kontakten" ein sehr launisches Bauteil das
manchen Telegrafisten zur Verzweiflung gebracht haben soll.
Kohärer und "Klopfer" (Ausschnittsvergrösserung):

8.1 Ein 100 Jahre altes Buch über Elektrotechnik
Anmerkung von mir: Beim ersten Bild fällt mir der Name Braun auf. Zu
Ehren dieses Mannes möchte ich zum Schluss dieses Kapitels ein paar
Worte widmen:
Lange vor der damals revolutionären Erfindung der Radioröhre, u.a. von
Lieben die Triode, wurde an technischen Hochschulen mit Funkensendern
über grosse Distanzen experimentiert. Ein wichtiger Pionier gegen Ende
des vorletzten Jahrhunderts war Marconi. Anstatt von Eisenpulver
verwendete er im Fritter Nickelpulver, da es weniger leicht oxydiert als
Eisenpulver. Weitere berühmte Pioniere waren Slaby und Braun. Braun
soll der einzige gewesen sein, der Marconis Prinzip richtig verstanden
hat. Daraus entwickelte er die Methode die Funkenstrecken induktiv per
Schwingkreis anzukoppeln. Für diese Arbeit erhielt Braun sogar den
Nobelpreis.
Diesen Abschnitt habe ich leicht verändert aus einem Originalbuch aus
dem Jahre 1909 mit dem Titel Elektrotechnisches Experimentierbuch
von Eberhard Schnetzler übernommen. Jochen Zilg, der Schreiber des
Vorwortes
meiner Elektronik-Minikurse, schenkte mir ein Exemplar, da er zwei davon
hatte:
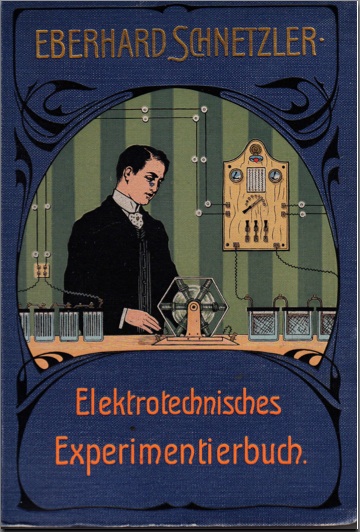
Da dieses Buch nur noch im Zentralen Verzeichnis Antiquarischer Bücher (ZVAB), falls aktuell vorhanden, erhältlich ist, hat Herr Dr. Rainer Köthe dieses Werk erworben und eingescannt. Er war so freundlich, dass ich dieses Buch zum Downloaden hosten darf. Und so steht dieses historische Werk allen zur Verfügung, die sich fuer die Geschichte der praxisbezogenen Elektrotechnik interessieren:
-
Download: Elektrotechnisches Experimentierbuch von Eberhard Schnetzler
(ZIP-Datei = 240 MByte entpackt als PDF)
9. Amusanter Auszug aus dem 100 Jahre alten Buch
9.1 Der Funkeninduktor und der selbstgebaute Kondensator
Wir wissen, dass die Spannung des Induktionsstromes mit von der
Geschwindigkeit abhängt, mit welcher der erregende Strom unterbrochen
wird. Ferner wissen wir, dass an der Unterbrechungsstelle jeweils ein
Funke auftritt, wenn der Strom geöffnet wird. Das Aufreten des Funkens
zeigt uns aber, dass der Strom nicht plötzlich unterbrochen wird, das
heisst nicht in der kurzen Zeit von einem von seinem normalen Wert auf
Null herabsinkt, in der die tatsächliche Trennung des Leiters erfolgt,
sondern dass er infolge der Selbstinduktion den Luftzwischenraum anfangs
überwindend, nur allmählich schwächer wird, bis er ganz unterbrochen
ist.
Wollen wir also die Wirkung eines Induktionsapparates verstärken, so
müssen wir danach trachten, den Funken an der Unterbrechungsstelle
möglichst zu verkleinern.
Ab dieser Stelle musste ich den Text leicht anpassen, damit er zu Bild 2 passt:
Wir betrachten das Schema in Bild 2 links, in welchem EK den Eisenkern, P die primäre, S die sekundäre Wickelung ("Wickelung" ist kein Schreibfehler!), B eine Batterie als Stromquelle, EA den Eisenanker und K die Unterbrechungsstelle bezeichnet. Wenn wir den an K enstehenden Funken verkleinern wollen, so müssen wir die Spannungsdifferenz zwischen den beiden offenen Kontaktstellen verringern, was wir dadurch erreichen, dass wir die Kapazität vergrössern, in dem wir den Kondensator C an sie anschliessen, wie dies Bild 2 zeigt.
Der Kondensator muss eine grosse wirksame Fläche haben und wird deshalb aus einzelnen Stanniolblättern (damals Zinn-Folie) hergestellt, die von Papier untereinander isoliert sind. Er wird in einem Kasten untergebracht, der zugleich die Grundlage für die Induktorrolle bildet, und von der Grösse dieser hängen auch die Masse des Kastens ab. Die isolierenden Papierblätter schneiden wir aus nicht zu dünnem Seidenpapier (oder dünnem Paraffinpapier) so gross, dass sie etwa 0.5 cm Spielraum in dem Kasten finden. Die Stanniolblätter müssen 1 bis 2 cm kleiner sein, als die Papiere und auf einer Seite einen 4 bis 5 cm langen Fortsatz haben (Kontaktstellen). Um die Isolierfähigkeit der Seidenpapiere zu erhöhen, werden sie in Schellacklösung gebadet. In ein flaches Gefäss, etwa eine hinreichend grosse Entwicklungsschale, wie sie in der Photographie gebraucht werden, giessen wir den Schellack. Die zugeschnittenen Seidenpapiere werden dann einzeln durch die Lösung gezogen und mit je zwei Stecknadeln an einer aufgespannten Schnur zum Trocknen aufgehängt. Danach werden Stanniolblätter, durch die schellackierten Papiere voneinander getrennt, so aufeinander gelegt, dass beim ersten Fortsatz nach rechts, beim zweiten nach links, beim dritten wieder nach rechts u.s.w. herausragt. ... ... ...
Tja und so geht das noch lange weiter mit der Anleitung - heute sagt man Application-Note - einen Kondensator selbst zu bauen; dies in einer Zeit, als man diese passiven Bauteile noch lange nicht ganz selbstverständlich bei Distrelec, Farnell oder andern Grossdistributoren aus einem Riesensortiment auswählen und bestellen konnte. Nicht nur in dieser Sache hat sich in den letzten 100 Jahren enorm viel verändert...
10. Der KOSMOS-Radiomann
Die folgende Webseite wird manch Bastlerherz aus alter Zeit höher
schlagen lassen. All diejenigen welche heute zwischen 50 und mehr als 60
Jahre alt sind, werden sich noch gut an die Zeiten dieses
Lern-Baukastensystems erinnern. Die Schule Walenstadt hat sich zur
Aufgabe gemacht eine Erinnerungswebseite zu gestalten, die ich
natürlich den interessierten Elektronik-Geschichte-Lesern nicht
vorenthalten möchte. Gefunden habe ich diese Webseite mit Google und dem
Eintrag "wagner'scher hammer". Wir wissen ja jetzt, was es mit diesem
Hammer auf sich hat... :-)
Diese Erinnerungs-Webseite enthält auch schöne Bilder, wie z.B. den
Funkeninduktor aus dem KOSMOS-Lehrmittelverlag in Stuttgart. Ich wünsche
allseits viel Spass und dass diese Webseite noch lange erhalten bleibt:
- Der KOSMOS-Radiomann: Vom Gebirg bis zum Ozean, alles hört der Radiomann!